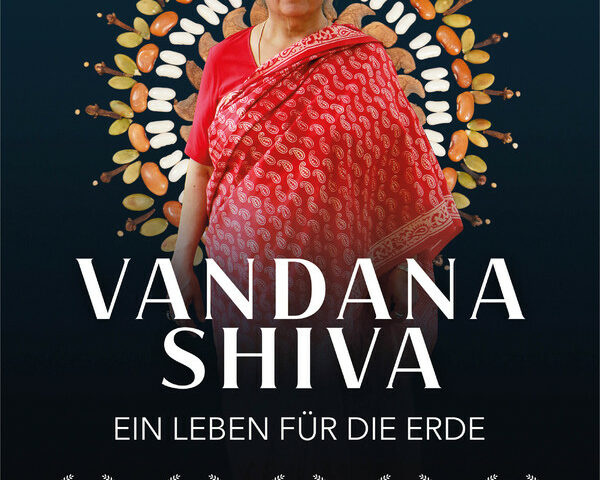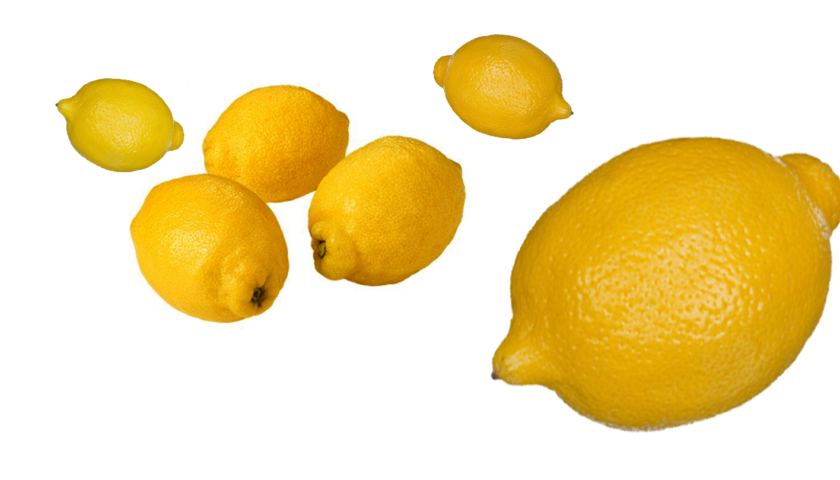Biel hat die besten Voraussetzungen, die Lebensmittelherstellung wieder in den Mittelpunkt zu stellen, sagt unser Autor und setzt zu Teil 2 seines Berichts an: Eigenes landwirtschaftliches Land, eine Vielzahl an verarbeitenden Betrieben und eine wachsende Anzahl an Konsument*innen, die zu Akteur*innen eines nachhaltigen und lokalen Ernährungssystems werden möchten. Im ersten Teil («Die Stadtutopie zurückbringen», Nr. 49 vom Juni 2024) ging es um die Rolle der Genossenschaften zu Beginn ihrer Geschichte und das Modell der Gartenstädte als Prinzip der Selbstversorgung. «Wo, wenn nicht in der Stadt und unmittelbar um sie herum? Und durch wen, wenn nicht durch die Stadtbevölkerung selbst?», fragt sich Tex Tschurtschenthaler, Aktivist der ersten Stunde der sogenannten Solawi (Solidarische Landwirtschaft) und Mitglied des Projektes «Stadt-Garten für alle» in Biel. Letzteres verfolgt die Idee, auf städtischem Land eine Solawi zu entwickeln. Eine Vision für 2035 hin zu einer klimaresilienten Stadt Indem wir den Anteil unseres Konsums an industriell hergestellten
WeiterlesenAutor: Mathias Stalder
Die Stadtutopie zurückbringen
Die Gartenstädte, hervorgebracht von Ebenezer Howard (1850-1928), sind eine konkrete und gelebte Utopie. Sie veränderten den Blick auf die Stadt fundamental, sind noch heute zukunftsweisend und fanden auch in Biel u. a. durch den Architekten Eduard Lanz ihre Verwirklichung. Mit 38 Jahren liest der Londoner Büroangestellte Ebenezer Howard (1850-1928) das Buch «Ein Rückblick aus dem Jahr 2000» von Edward Bellamys, das ein ideales Gemeinwesen beschreibt. Davon inspiriert, verfasst Howard «Tomorrow. A Peaceful Path to Real Reform» (1898). Er entwirft darin die Gartenstädte. Das Ziel: die Aufhebung von Stadt und Land durch ländliche Wohnsiedlungen, Fabriken und Kultur. Ein wichtiges Merkmal ist die Kollektivierung von Grund und Boden zur Vermeidung von Spekulation, nicht alle Gartenstadtsiedlungen folgen jedoch diesem Punkt. Kernpunkt ist auch die Selbstversorgung mit Energie und Lebensmittel, denn Parks und Gärten nehmen einen grossen Teil der Stadtfläche ein. Sämtliche Bereiche der Stadt sind per Fuss oder Rad zugänglich, selbst die Arbeitsplätze,
WeiterlesenVandana Shiva – wofür sie sich einsetzt
Heldin, radikale Wissenschaftlerin, Aktivistin, Feministin und Saatguthüterin, das alles und noch viel mehr ist Vandana Shiva. In der Stadt Dehradun in Nordindien im Jahr 1952 geboren, wuchs sie in den Wäldern der Vorberge des Himalayas auf. Diese prägende Erfahrung mit dem Wald – ihr Vater war Forstwart – führte sie schon in den 1970er-Jahren in die Chipko-Bewegung. Die mehrheitlich von Frauen getragene Bewegung wehrte sich gegen die Abholzung der Wälder. Ihre Mutter war Schulinspektorin und arbeitete später in der Landwirtschaft. Vandana Shiva hat einen Master-Abschluss in Physik und Wissenschaftsphilosophie. Und gehört zu den führenden globalisierungskritischen Stimmen. Sie ruft zum Ungehorsam gegen die Ausbeutung von Mensch und Natur durch die multinationalen Konzerne und den globalen Kapitalismus auf. Dabei kritisiert sie vehement die Agroindustrie und die Kolonialisierung der Welt durch die 1%. Anfang der 1980er-Jahre gründete sie das Institut The Research Foundation for Science Technology and Ecology (RFSTN), das Netzwerk Navdanya (Neun Saaten
WeiterlesenBlick zum Fenster raus
Wie eine neue Siedlung entsteht, aus dem Einzelnen ein kleines Dorf. Ein Einblick in die Wasenstrasse – Wohnbaugenossenschaft mit grosser sozialer Durchmischung und noch grösserem Potenzial. Friedensreich Hundertwasser (1928 – 2000), der bekannte Künstler und Architekt, vehementer Gegner jeder Standardisierung und «gerader Linie», sprach von drei Häuten, die uns umgeben. Die erste Schicht ist unsere natürliche Haut, dann folgt die der Kleider und als letzte die Mauer, unsere Wohnung oder Haus. In allen soll sich der Mensch wohlfühlen, allesamt sind intim und persönlich. Die Fenster, so Hundertwasser, sind Brücken zwischen dem Innen und Aussen. Als einer der ersten Mieter lebe ich seit August 2016 in der Siedlung Wasenstrasse, welche Teil der Bieler Wohnbaugenossenschaft biwog ist. Die Wohnungen fanden nur zögerlich neue Bewohner*innen; das Leben, erschwert durch die Baustelle des Neubaus, fand sich nicht zurecht. Das war der Ausgangspunkt der Equipe Bonwasinage, von drei Personen ins Leben gerufen, um der Siedlung
WeiterlesenSolidarität ist Handarbeit
Gefährdung der Gesundheit am Arbeitsplatz, Stress mit dem Chef, Kündigung, Erwerbsausfall, Kurzarbeit oder andere Problemn wegen der Coronakrise – Über das Corona-Solifon unterstützen sich Arbeiterinnen und Arbeiter gegenseitig. Ein Gespräch mit Mitgründer Johannes Wetzel zur organisierten Selbsthilfe in Zeiten der Krise. Ein Jahr Corona-Solifon. Auf welche Erfahrungen blickt ihr zurück? Johannes Wetzel: Solifon ist eine Initiative des basisgewerkschaftlichen Umfelds vor allem aus der Deutschschweiz – spontan ins Leben gerufen im März 2020, also gleich zu Beginn der Coronapandemie. Es war wirklich schön mit welcher Selbstverständlichkeit einige entschlossene und motivierte Menschen das Solifon so schnell auf die Beine gestellt haben, ohne dass wir uns alle untereinander kannten. Die Wissensweitergabe und Selbstermächtigung war unser zentrales Motiv. Alle von uns hatten unterschiedliche Grundlagen, was Arbeit-, Sozial- und Mietrecht angeht. Alles in allem konnten wir rund 100 Anrufenden eine fundierte Rückmeldung geben, sie in ihrer Auseinandersetzung unterstützen oder an andere Stellen weiterleiten. 20 bis
WeiterlesenTausende Früchte über die Grenze geholt
Ausserhalb der Reichweite der Mafia gedeiht in Kalabrien die Landkooperative SOS Rosarno. Doch dann kam Corona und mit dem Lockdown geriet das Projekt mitten in der Zitrusfrucht-Ernte in Not. Ursin Della Morte und Freunde riefen in Bern kurzerhand den Konsumverein Solrosa ins Leben, um den Italienern Einkommen und Arbeit zu sichern. Ein Beispiel grenzüberschreitender Solidarität durch fairen Handel. Mathias Stalder: Im März 2020 erreichte euch ein Telefonanruf aus dem Süden Italiens. Was geschah daraufhin?Guiseppe Pugliese von der Landkooperative SOS Rosarno sagte uns, dass die Stimmung in Kalabrien sehr bedrückt sei. Im Gegensatz zu Norditalien gab es dort kaum Fälle von Covid-19, aber die Ausgangssperren galten im ganzen Land, unabhängig von den Fallzahlen. Im Mezzogiorno (Anm. d. Red.: Süditalien), wo viele ein halblegales oder informelles Einkommen haben, führten die Ausgangssperren direkt zu einer heftigen Verarmung bis hin zu Hunger, da nur aus dem Haus durfte, wer eine Bescheinigung des Arbeitgebers hatte.
WeiterlesenIndonesien – auf dem Weg zur Autokratie
Am 7. März 2021 stimmen wir über das Freihandelsabkommen (FHA) mit Indonesien ab, darin sind erstmalig Nachhaltigkeitskapitel für Umwelt- und soziale Normen festgehalten. Es fehlen aber wirksame Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten und eine Gerichtsbarkeit, kritisiert eine Referendumsallianz von über 50 Organisationen. Deshalb lehnen wir dieses Freihandelsabkommen ab – das Nachhaltigkeit verspricht, aber eine Politik, die Mensch und Umwelt schadet, zementiert. Freihandel befeuert den Palmölkonsum Jedes Jahr brennen die Wälder und Moore in Indonesien, denn die Brandrodung ist die billigste Methode, um Platz für neue Palmölplantagen zu schaffen. Im Jahr 2019 wurden so 300’000 Hektaren Naturlandschaft zerstört, eine Fläche grösser als der Kanton Tessin. Indonesien reiht sich damit zu den grössen Co2-Verursachern der Welt. Mit den Wäldern sterben nebst der gesamten Flora und Fauna auch die letzten Orang-Utans und Sumatra-Tiger. Multinationale Konzerne wie Nestlé und Unilever beziehen ihr Palmöl nachweislich von Firmen, die an den Brandrodungen und Landraub beteiligt sind. Freihandelsabkommen sind
WeiterlesenDie Realität sieht anders aus
Die Knospe ist sozial und fair, so steht es im Jahresbericht 2019 von Bio Suisse. Salome Günter, Geographie-Studentin an der Universität Bern, hat das im Rahmen ihrer Bachelorarbeit genauer untersucht und von Saisonarbeitenden auf einem Biobetrieb im Grossen Moos durchaus etwas anderes beschrieben bekommen. Unterwegs und selber mittendrin war sie mit der Forschungsfrage: Wie wirken sich die Arbeitsbedingungen im biologischen Gemüsebau auf die Lebensqualität der Saisonarbeitenden und Betriebsleiter im Grossen Moos aus? Sozial und fair – ist Bio tatsächlich besser? Besser für wen? Für die Konsumierenden, für die Saisonarbeitenden oder für die Natur? Dies ist die entscheidende Frage, denn Konsumierende meinen oft: «Ah eine Bio-Tomate, da ist alles super, alles nachhaltig». Die Nachhaltigkeit besteht jedoch aus drei Säulen, der ökonomischen, der ökologischen und der sozialen Nachhaltigkeit. Nur wenn alle drei berücksichtigt werden und langfristig in einem Gleichgewicht zueinander stehen, kann von Nachhaltigkeit gesprochen werden. Bio in der Schweiz ist ökologisch
WeiterlesenStop Palmöl
Die bäuerliche Gewerkschaft Uniterre lanciert nun das Referendum gegen das Freihandelsabkommen mit Indonesien. Ein konsequenter Schritt nach einem ermurksten Kompromiss auf politischer Ebene, bei dem der Klimaschutz links liegen gelassen wurde. Zur Vorgeschichte: Am 1. November 2018 wurden die Verhandlungen für ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Freihandelsassoziation EFTA (Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein) und Indonesien beendet. Das Schweizer Parlament hat nun dem Wirtschaftsabkommen am 20. Dezember 2019 auf dem bilateralen Weg zugestimmt. Bereits im Vorfeld kritisierte die Palmöl-Koalition, ein Zusammenschluss von verschiedenen NGOs, die fehlende Verbindlichkeit und Transparenz des Abkommens. Sie forderte vergeblich, das Palmöl aus dem Abkommen auszuschliessen. Darum jetzt der Entscheid der bäuerlichen Gewerkschaft Uniterre, das Referendum zu ergreifen. Eine grüne Wüste In Indonesien liegen 10 – 15 Prozent des tropischen Regenwalds der ganzen Welt. Alleine in den ersten fünf Monaten des Jahres 2019 sind 43 000 Hektaren abgebrannt. Immer grössere Flächen des Regenwaldes werden abgeholzt, uralte CO2-Speicher entleeren sich in die Atmosphäre
WeiterlesenEin Label fürs Seeland
Es herrscht Wildwuchs bei den regionalen Labels der Gross- und Kleinverteiler mit zum Teil happigen Aufpreisen ohne eigentliche Mehrleistung bei der Nachhaltigkeit und dem Tierwohl. «Genève Région – Terre Avenir» macht es seit 2004 erfolgreich vor. Über 360 Betriebe sind in Genf dabei und vermarkten über 500 Produkte. Die Prinzipien sind einfach: Qualität (u.a. gentechfrei), Nähe, Transparenz und Fairness (faire Arbeitsbedingungen). Das Label «Ambassadeur du Terroir genevois» gibt regionalen Produkten in der Gastronomie den Vorzug. Das Label fördert die Wettbewerbsfähigkeit, die Wertschöpfung sowie die Innovation in der Region. Warum nicht ein solches Label für das Seeland und den Berner Jura? Mit geschärften Kriterien wie in Genf, bezüglich Ökologie, Tierwohl und Biodiversität. Etliche Qualitätslabels in Deutschland machen es vor. Ein solches Labelprojekt möchte der Ernährungsrat Biel im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP) bis zum Sommer 2019 einreichen. Lesetipp: Traumpaar Biodiversität und Regionalvermarktung – Praxisleitfaden für Regionalinitiativen: Biodiversität als Element neuer Produktions-
Weiterlesen